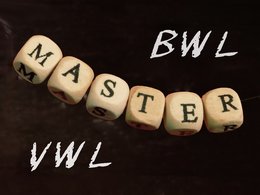Bachelor-Studium soll besser auf Arbeitsmarkt vorbereiten
Die Qualität der Bachelorstudiengänge und die Vorbereitung der Studenten auf den Arbeitsmarkt 4.0 sollen verbessert werden. Kultusministerkonferenz (KMK) und Hochschulrektorenkonferenz (HRK) haben verschiedene Schritte zur Optimierung der Europäischen Studienreform veröffentlicht. Dabei rückt auch die Thematik Digitalisierung im Rahmen der Hochschule in den Fokus. Mittlerweile integrieren fast Dreiviertel aller deutschen Hochschulen digitale Konzepte in die Lehrinhalte vom Bachelor-Studium.

Bachelor-Studium soll besser auf Arbeitsmarkt vorbereiten
Bonn, 21.07.2016 (hrk) - Hochschulen, Gewerkschaften und Arbeitgeber sehen in der Hochschulbildung zur Thematik Arbeitswelt 4.0 und in der damit verbundenen Beschäftigungsfähigkeit von Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen für den Arbeitsmarkt ein Schlüsselthema für die Zukunft von Deutschland. Was dies bedeutet und welche Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen Bachelor-Absolventinnen und Bachelor-Absolventen oder Master-Absolventinnen und Master-Absolventen mitbringen müssen, um auf dem Arbeitsmarkt 4.0. erfolgreich zu sein, darüber haben sich jetzt Vertreterinnen und Vertreter von Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und Deutschem Gewerkschaftsbund (DGB) gemeinsam mit weiteren Akteuren verständigt. In einer gemeinsamen Erklärung betonen sie ihre Entschlossenheit, die jeweiligen Aufgaben im Dialog aller Partner wahrzunehmen:
HRK-Vizepräsident Prof. Dr. Holger Burckhart: Im Austausch mit der beruflichen Praxis entwickeln die Hochschulen ihre Studiengänge kontinuierlich weiter und unterstützen die Studierenden beim Aufbau wissenschaftlicher und berufsfeldbezogener Kompetenzen. Zentrales Merkmal akademischer Bildung ist und bleibt aber die wissenschaftliche Problemlösungskompetenz. Wir bilden also nicht für einen konkreten Arbeitsplatz aus. Aber so, wie wir den jungen Menschen mit dem Abitur eine allgemeine Hochschulreife geben, wollen wir ihnen mit Bachelor und Master eine allgemeine Arbeitsplatzreife, das heißt eine wissenschaftliche Befähigung für Karrieren in und außerhalb der Hochschulen, geben.
BDA-Vizepräsident Dr. Gerhard F. Braun: Die Hälfte der Fachhochschul- und zwei Drittel der Uniabsolventen sind mit dem Praxisbezug des Studiums und der Vorbereitung auf eine Beschäftigung durch die Hochschule unzufrieden. Darum wollen wir die Kooperation zwischen Hochschulen und Unternehmen weiter stärken. Auch die Digitalisierung der Arbeitswelt macht eine engere Zusammenarbeit beider Seiten notwendig. Theorie und Praxis im Studium bilden keinen Gegensatz, sondern ergänzen sich gegenseitig. Praxisbezüge sind ebenso wie Forschungsbezüge wesentliche Elemente des Studiums, bereiten auf eine berufliche Tätigkeit vor und können Abbruchquoten senken.
Stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack: Nicht zuletzt durch die rasante technologische Entwicklung ändern sich die Anforderungen der Arbeitswelt stetig. Die Hochschulen sind gefragt, die Studierenden beim Erwerb jener Kompetenzen zu unterstützen, die notwendig sind, damit sie diesen Wandel bewältigen, die Arbeitswelt aktiv mitgestalten und Verantwortung im Beschäftigungssystem und in der Gesellschaft übernehmen können. Ein Studium sollte immer ein breites Spektrum an Beschäftigungsfeldern eröffnen. Es darf nicht zu sehr auf Einzelbetriebe oder konkrete Tätigkeiten zugeschnitten sein. In diesem umfassenden Sinne ist ein Studium auch eine wissenschaftliche Berufsausbildung.
Klares Bekenntnis zur Europäischen Studienreform
In einer am Freitag herausgegebenen gemeinsamen Erklärung ziehen die Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz eine grundsätzlich positive Zwischenbilanz des 1999 in Bologna eingeleiteten Reformprozesses. Kernanliegen des gemeinsamen Europäischen Hochschulraums, auf den sich mittlerweile 48 Staaten verständigt haben, seien weitreichend an den Hochschulen etabliert. Dazu zählen insbesondere das zweistufige Studiensystem mit den Abschlüssen Bachelor und Master, Qualitätssicherung auf der Grundlage gemeinsamer Standards und Leitlinien sowie Transparenzinstrumente zur Anerkennung von Studienleistungen.
KMK und HRK verweisen auf die beeindruckenden Reformanstrengungen der Hochschulen, dank derer der Bologna-Prozess inzwischen in Deutschland nahezu flächendeckend umgesetzt ist. Auf Kritik von Studierenden und Lehrenden hatten die Länder 2009/2010 mit einer Überarbeitung der ländergemeinsamen Strukturvorgaben für Bachelorstudiengänge und Masterstudiengänge reagiert, die vor allem auf eine Verbesserung der Studierbarkeit der Studiengänge und der Qualität der Lehre sowie auf eine stärkere Förderung der Mobilität abzielte.
Sinnvolle Schritte zur Weiterentwicklung der Qualität von Bachelorstudiengängen und Masterstudiengängen:
-
Zur weiteren Steigerung der Mobilität werden die Hochschulen aufgefordert, die Anerkennungsverfahren nach den Grundsätzen der Lissabon-Konvention und auf Grundlage eines breiten Kompetenzverständnisses in der Praxis transparenter zu gestalten und zu standardisieren, sofern sie dies nicht bereits getan haben.
-
KMK und HRK sprechen sich nachdrücklich dafür aus, das bestehende Kapazitätsrecht weiterzuentwickeln. Ziel soll es sein, den Hochschulen mehr Flexibilität bei der Gestaltung von Studienverläufen zu ermöglichen und den Mehraufwand für qualifizierte Lehre angesichts einer zunehmend heterogenen Studierendenschaft zu berücksichtigen.
-
KMK und HRK begrüßen es ausdrücklich, dass die Systemakkreditierung von immer mehr Hochschulen angewandt wird. Bisherige und internationale Erfahrungen sollen in ihre Weiterentwicklung einfließen. Allerdings müsse auch die Programmakkreditierung als Möglichkeit erhalten bleiben. Diese sollte ihrer Aufgabe als Instrument der Reakkreditierung besser als bisher gerecht werden und stärker der gewachsenen Hochschulautonomie Rechnung tragen.
-
Die ländergemeinsamen Strukturvorgaben sowie die Akkreditierung haben unter Wahrung der Hochschulautonomie zur Entstehung einer institutionellen Qualitätskultur, besonders in Bezug auf die Lehre, beigetragen. HRK und KMK sind sich einig, dass beide Instrumente weiterentwickelt werden müssen. Sie weisen aber darauf hin, dass die ländergemeinsamen Strukturvorgaben bereits heute Spielräume bieten, die von den Hochschulen stärker genutzt werden sollten.
- Zusätzlich zur absoluten Note soll bei Bachelorzeugnissen ein Prozentrang aller vergebenen Noten aufgeführt werden. Dies dient der Transparenz und der Fairness gegenüber Studierenden, Hochschulinstitutionen und potentiellen Arbeitgebern.